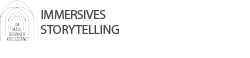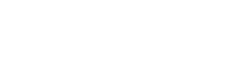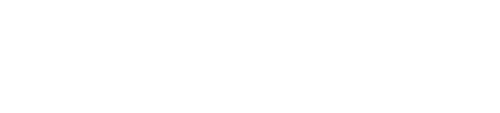Durch die Steigerung des Bekanntheitsgrades virtueller Realitäten und dem mittlerweile verhältnismäßig einfachen Zugang zu der benötigten Ausstattung, sind der Umsetzung derartiger Produktionen aus technischer Sicht kaum mehr Grenzen gesetzt. Die aufkommende Frage, wie der durch immersive Medien entstandene neue Zugang zu Erzählungen eingesetzt werden kann, um die Medienwirkung bestmöglich zu entfalten, birgt jedoch zahlreiche Herausforderungen für Medienschaffende. Immersive Medien stehen derzeit vor dem Problem, oftmals ohne Anspruch an gute Narrationen präsentiert zu werden. Will man eine Geschichte im Kontext der virtuellen Realität erzählen, muss man die bisher gewohnten Gesetze der narrativen Strukturen des klassischen Bewegtbilds in Frage stellen. Eine Übersetzung in das neue Medienumfeld wird erforderlich.
Geschichten erzählen in den immersiven Medien Virtual Reality und
360°-Video
Geschichten in immersiven Medien erzählen
Herausforderung
Zielsetzung
Aus gegebenem Anlass beschäftigt sich die vorliegende Arbeit zentral mit der Wirkung und Neugestaltung narrativer Strukturen innerhalb der immersiven Medien Virtual Reality und 360-Grad-Video. Die Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt am Beispiel des Anwendungsfeldes der dokumentarisch erzählerischen Darstellungsformen.
Ziel der Arbeit ist es dabei, Medienwirkung und Narration im immersiven Umfeld aus technischer und gestalterischer Perspektive zu verstehen. Darauf basierend werden gewonnene Erkenntnisse evaluiert und detaillierte Handlungsempfehlungen zur Narrationsentwicklung in den immersiven Medien Virtual Reality und 360-Grad-Video abgeleitet. Im Rahmen der Arbeit wurde hierzu ein Sechs-Phasen-Modell der Narrationsentwicklung im Umfeld immersiver Medien ausgearbeitet.
Vorgehen und Methodik
Das Vorgehen der Arbeit zur Zielerreichung basiert auf anwendungsorientierten und theoretischen Methoden, die insgesamt einem interdisziplinären Forschungsansatz folgen:
- Wissenschaftliche Aufarbeitung einschlägiger Fachliteratur zur Bildung theoretischer Grundlagen.
- Produktion und Reflexion des dokumentarisch erzählerischen Fallbeispiels Im Maulbronner Kreuzgang. Produziert wird Version A als 360-Grad-Video, während Version B als klassisches Video bei gleichem narrativen Inhalt umgesetzt wird.
- Erhebung und Ergebnisauswertung einer quantitativen Medienrezeptionsstudie durch A/B-Testing. Als Stimuli dienen die beiden Video Versionen des Fallbeispiels. Eine Befragung erfolgt zu transsituativen Persönlichkeitsmerkmalen und erfahrungsnahem Rezeptionserleben.
- Interviews mit vier praxisnahen Experten aus den Fachgebieten Produktion, Journalismus und Konzeption im Umfeld immersiver Medien.
Inhalte der Arbeit
- Theoretische und begriffliche Grundlagen
- Hintergründe zur Produktion “Im Maulbronner Kreuzgang”
- Erläuterung narrativer Strukturen in immersiven Medien
- Die Wirkung immersiver Medien auf den Betrachter
- Medienrezeptionsstudie am Fallbeispiel “Im Maulbronner Kreuzgang”
- Konkrete handlungsempfehlung in Form eines Sechs-Phasen-Modells der Narrationsentwicklung im Umfeld immersiver Medien
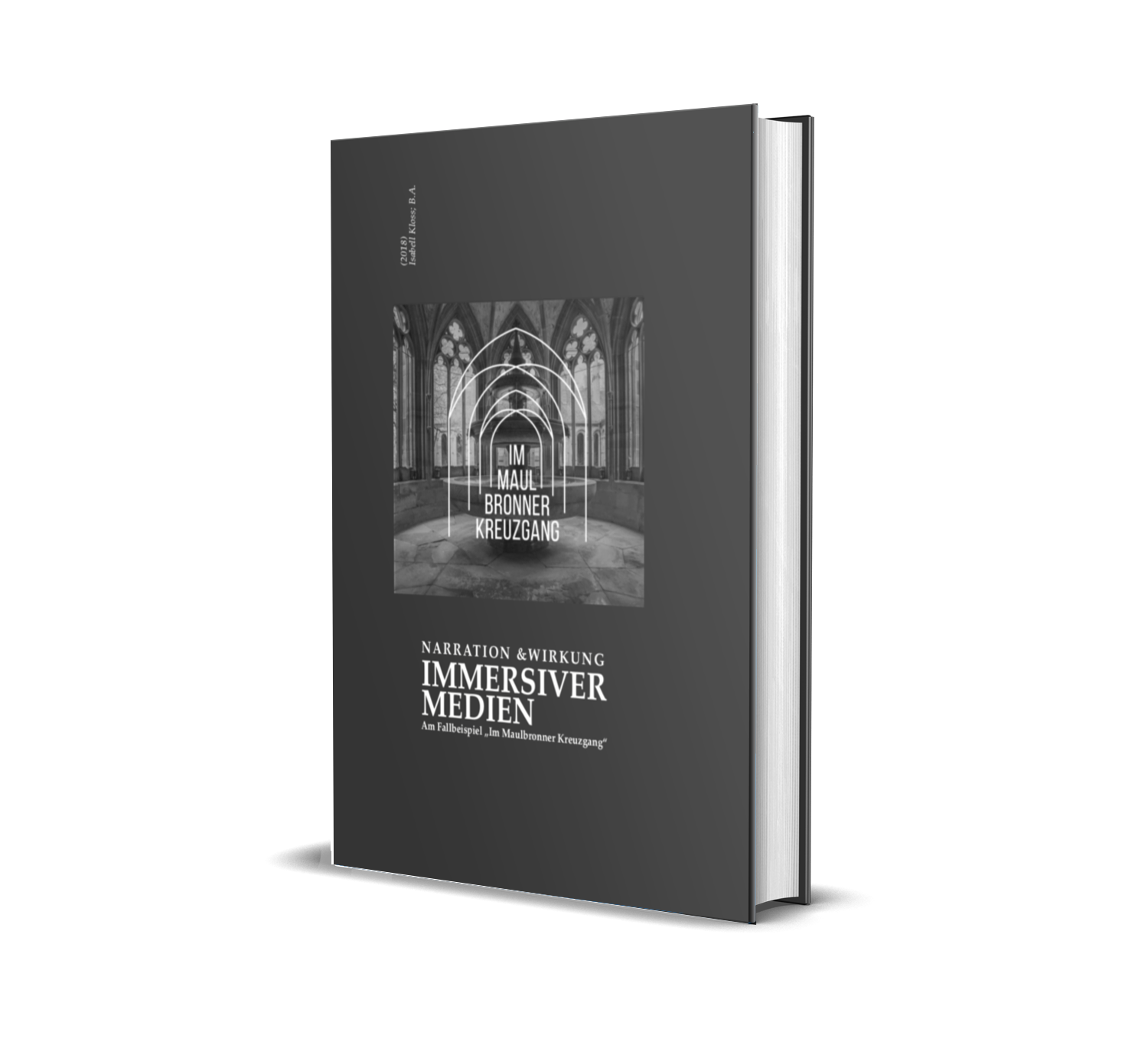 Cover
CoverDie Ergebnisse

1. Medium & Distribution
Der technische Rahmen ist für den Nar- rationsinhalt zunächst unerheblich. Dennoch wird der Handlungsspielraum für Narrationen im Hinblick auf Interaktionspotenziale und den Grad der Immersion wesentlich durch die Plattformentscheidung beeinflusst.
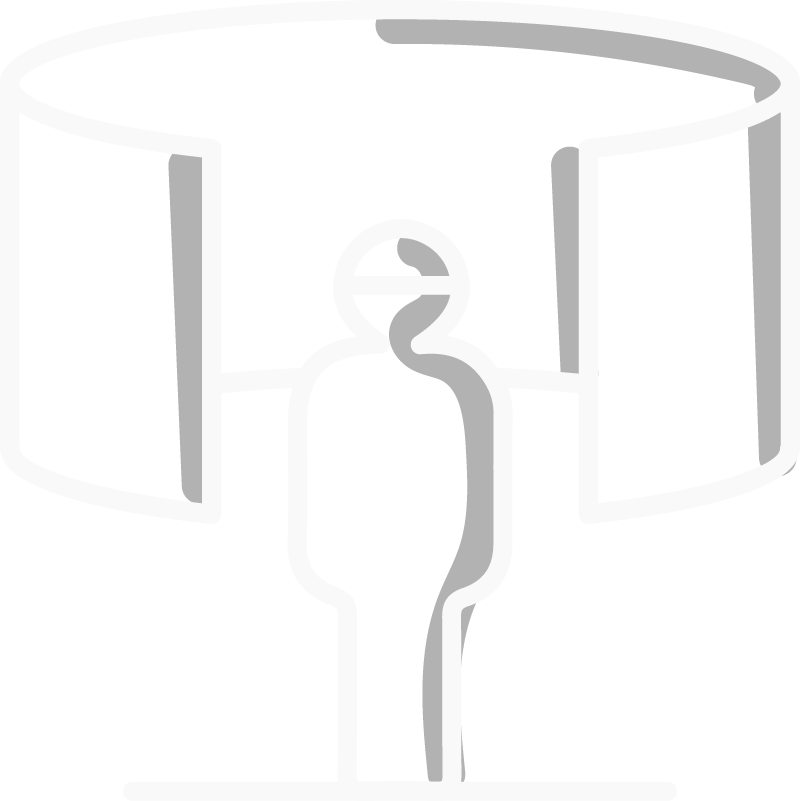
2. Zuschauerrolle
Es gilt, zwischen still vs. handelnd und Teilnehmer vs. Beobachter zu entscheiden. Alle weiteren Phasen der Narrationsentwicklung beruhen auf sphärischem Denken, ausgehend von der Rolle des Nutzers im Zentrum der Kugel. Die Geschichte muss den Rezipienten als Protagonisten behandeln und um ihn herum konzipiert werden.
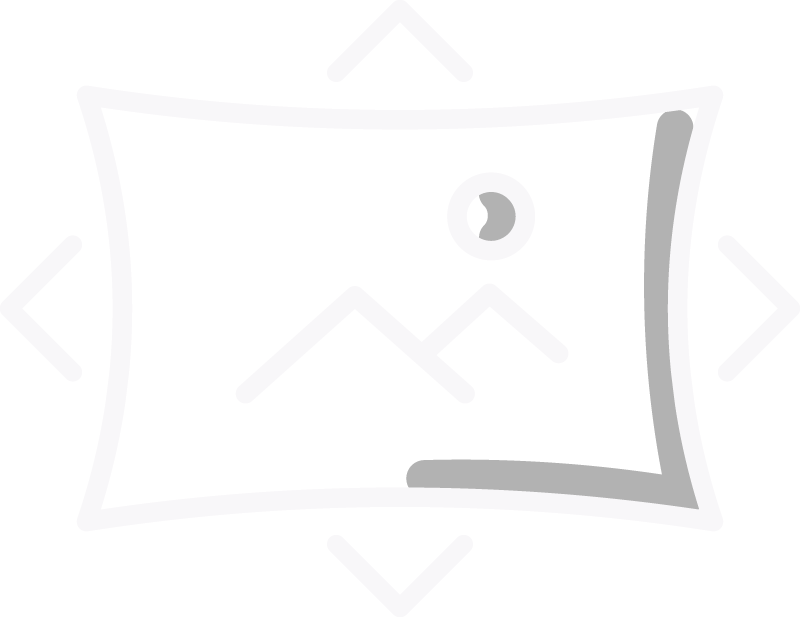
3. Narration
Besonders dienliche Stoffe sind Geschichten, die einen exklusiven Zugang zu einer Umgebung schaffen, eine neuartige Sicht auf ein Geschehen bieten, oder dem Zuschauer besonders viel Empathie abverlangen. Die grundlegende Handlung sollte in diesem Schritt unter Berücksichtigung der Rolle des Zuschauers ausformuliert werden.
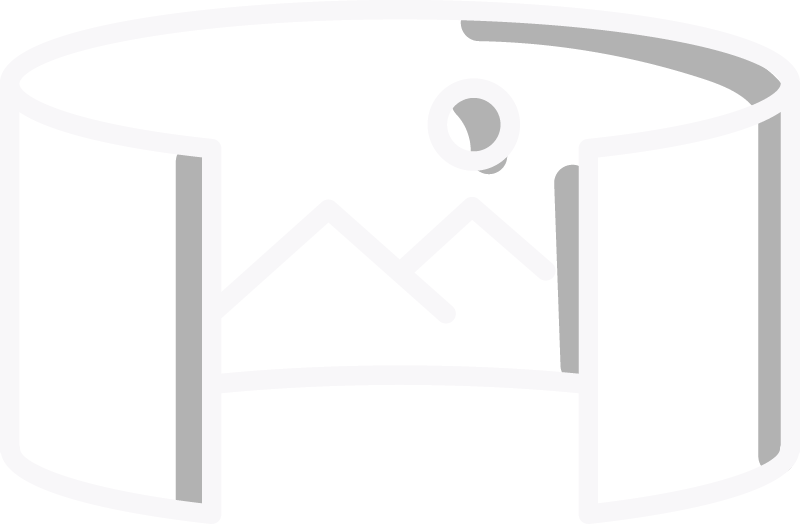
4. World Building
Der bereits konzipierte Kern des Geschehens wird hinterfragt und durch neue subnarrative Erzählfelder ergänzt, beziehungsweise angepasst. Der Kontext und die Umwelt des Geschehens werden detailliert gestaltet, um der Geschichte mehr Tiefe zu verleihen.
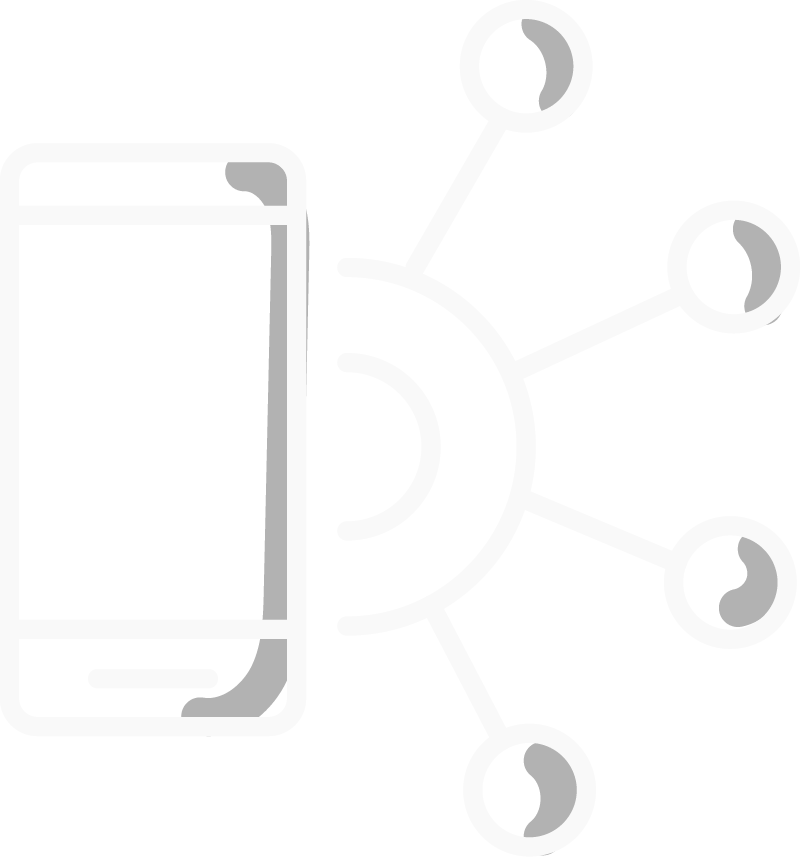
5. Linearität
Nachdem Die Erzählwelt und die Handlung weitgehend klar strukturiert sind, sollte eine Entscheidung zwischen Linearität oder Non-Linearität getroffen werden. Bei non-linearer Konzeption sind für alle Nutzer festgelegte Knotenpunkte notwendig, um das Verständnis des Geschehens zu sichern. Non-Linearität bringt insgesamt ein höheres Interaktionslevel und ein individuelleres Geschichtserleben mit sich.
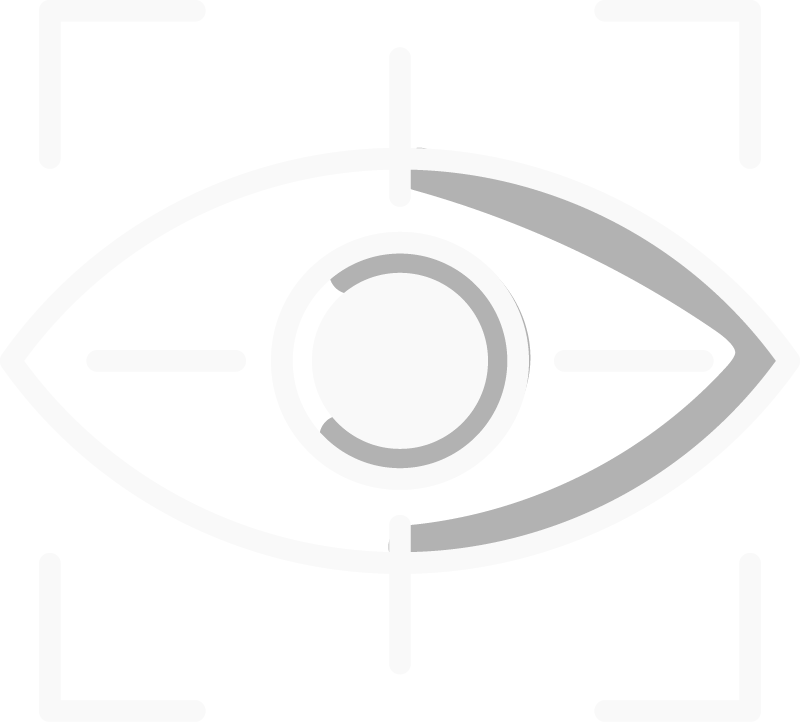
6. Storyboard
Alle Szenen werden aus der Vogelperspektive gezeigt. Eine choreographische Planung mit Laufwegen der Charaktere sowie für die Narration besonders wich- tige Inhalte, werden im Raum gekennzeichnet (Points of Interest). Auch Interaktionsmöglichkeiten können auf diese Weise markiert werden, um spätere Blickrichtungen des Nutzers möglichst treffsicher voraussagen zu können beziehungsweise diese zu lenken.
Die Arbeit zum Thema “Immersives Storytelling” hier kostenlos anfordern
Eine vollständige oder teilweise Verwendung der Inhalte, insbesondere von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder sonstigen Informationen oder Daten ist ausdrücklich erwünscht – allerdings ist es auch erwünscht, dass die Autorin sachgemäß zitiert wird.
Als Zitierweise im wissenschaftlichen Kontext wird vorgeschlagen:
„Kloss, I. (2018). Gestaltung und Wirkung narrativer Strukturen in den immersiven Medien Virtual Reality und 360°-Video (Bachelorarbeit, Hochschule der Medien). Immersives Storytelling. www.immersives-storytelling.de”

Isabell Kloss
E-Mail: mail@isabellkloss.com